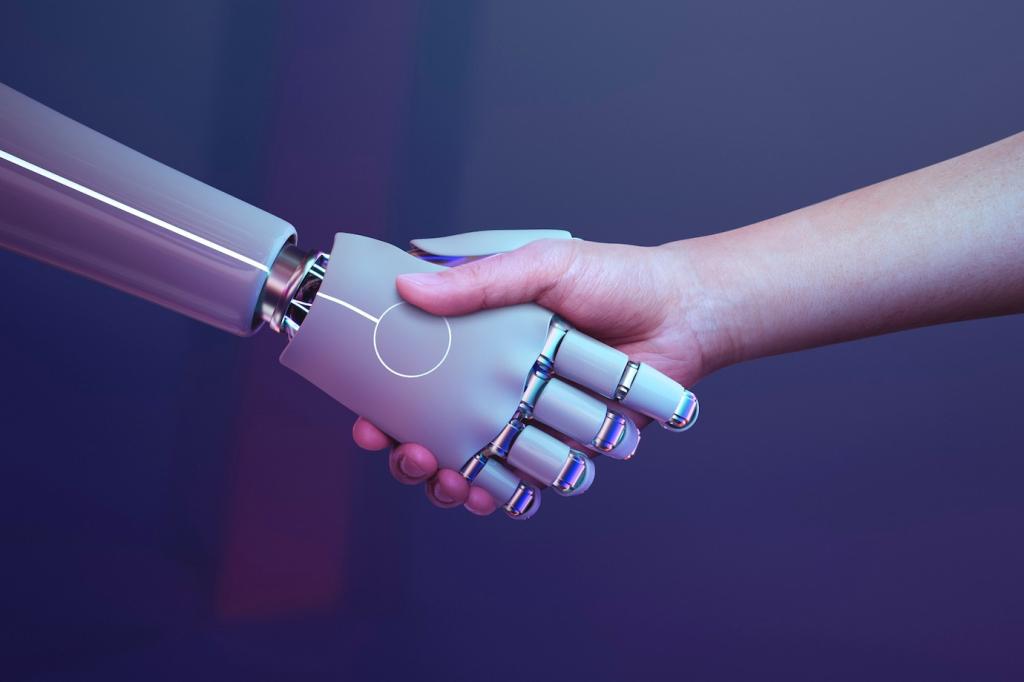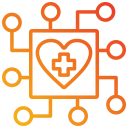This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Ethische Überlegungen bei KI-gestützten Gesundheitslösungen
Die Integration Künstlicher Intelligenz (KI) in den Gesundheitsbereich bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wirft jedoch auch bedeutende ethische Fragestellungen auf. KI-gestützte Systeme können Diagnosen verbessern, Behandlungswege optimieren und die Effizienz im Gesundheitswesen steigern. Zugleich entstehen neue Herausforderungen hinsichtlich Datenschutz, Transparenz, Verantwortlichkeit und Fairness. Diese Aspekte sind besonders bedeutsam, da Entscheidungen, die von KI-Systemen getroffen werden, unmittelbare Auswirkungen auf das Wohl von Patientinnen und Patienten haben können. In diesem Zusammenhang gilt es, technologische Innovation und ethische Grundwerte in Einklang zu bringen, um das Vertrauen in medizinische Anwendungen nachhaltig zu sichern.
Datensicherheit und Schutz sensibler Informationen
Einwilligung und informierte Zustimmung
Kontrolle über eigene Gesundheitsdaten
Transparenz und Nachvollziehbarkeit
Erklärbarkeit von KI-Entscheidungen
Offenlegung von Trainingsdaten und Algorithmen
Beteiligung der Betroffenen am Entscheidungsprozess